Warum Veränderung so schwerfällt – und wie sie trotzdem gelingen kann
- Janine Zika
- 28. Aug. 2025
- 3 Min. Lesezeit

Ein Blick ins Gehirn und auf die inneren Ressourcen
Jeder kennt sie: die guten Vorsätze, die motivierenden Pläne, die festen Entschlüsse. Und doch bleibt oft alles beim Alten. Warum fällt es uns so schwer, Veränderungen wirklich umzusetzen – selbst wenn wir sie wollen?
Die Antwort liegt nicht in mangelnder Disziplin oder fehlendem Willen, sondern tief in unserem Gehirn. Und genau dort beginnt auch der Weg zur nachhaltigen Veränderung.
Veränderung scheitert nicht am Wollen – sondern am inneren Widerstand
Neurobiologisch betrachtet ist es völlig normal, dass wir bei Veränderungsvorhaben ins Straucheln geraten. Denn unser Gehirn ist kein einheitlicher Entscheider, sondern ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Systeme.
Während das mesolimbische System für positive Gefühle wie Motivation und Vorfreude zuständig ist, verarbeitet die Amygdala gleichzeitig Ängste, Zweifel und Unsicherheit. Diese beiden Systeme arbeiten unabhängig voneinander – und genau das führt zu ambivalenten Gefühlen: Wir wollen etwas verändern, aber gleichzeitig fürchten wir den Verlust von Gewohnheit und Sicherheit.
Das erklärt, warum wir uns oft selbst sabotieren – nicht aus Schwäche, sondern aus einem biologisch nachvollziehbaren Schutzmechanismus.
Wenn das Leben uns zwingt: Warum große Krisen oft große Veränderungen ermöglichen

Tiefgreifende Veränderungen gelingen oft erst dann, wenn das Gewohnte plötzlich nicht mehr verfügbar ist – etwa nach einem Verlust, einer Krankheit oder einem anderen schicksalhaften Ereignis. In solchen Momenten wird die innere Sicherheitsarchitektur unseres Nervensystems erschüttert. Die vertrauten Muster, die uns bislang Orientierung gegeben haben, verlieren ihre Stabilität.
Die Polyvagal-Theorie des Neurowissenschaftlers Stephen Porges beschreibt, wie unser autonomes Nervensystem in solchen Situationen reagiert: Es wechselt vom Zustand sozialer Verbundenheit in einen überlebensorientierten Modus. Diese Umschaltung ist keine bewusste Entscheidung, sondern eine tief verankerte biologische Reaktion auf Bedrohung.
In diesem Zustand werden gewohnte Denk- und Verhaltensmuster oft außer Kraft gesetzt. Das Gehirn erkennt, dass das bisherige Selbstbild und die vertraute Lebensweise nicht mehr tragfähig sind. Was folgt, ist eine innere Neuverhandlung: Der Mensch beginnt, sich neu zu orientieren – nicht aus rationaler Überlegung, sondern aus einem tiefen Bedürfnis nach Sicherheit und Sinn.
Gerade in solchen Momenten wird Veränderung nicht nur möglich, sondern oft unausweichlich. Und obwohl sie aus der Not geboren ist, kann sie der Beginn einer echten Transformation sein.
Was tun – bevor das Leben uns zwingt?
Das Zürcher Ressourcen Modell als sanfter Weg zur Veränderung
Hier setzt das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) an – ein wissenschaftlich fundierter Selbstmanagement-Ansatz, entwickelt von Maja Storch und Frank Krause am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich. Ursprünglich konzipiert zur Burnout-Prophylaxe für Lehrkräfte, wurde das Modell seither kontinuierlich weiterentwickelt und findet heute breite Anwendung zur effektiven Begleitung von Veränderungsprozessen.
Es geht nicht darum, den inneren Widerstand zu bekämpfen, sondern ihn zu verstehen und mit den eigenen Ressourcen in Einklang zu bringen.
Das ZRM unterscheidet zwischen zwei Arten von Zielen:
Verstandesziele: „Ich sollte mehr Sport machen.“
Ressourcenaktivierte Ziele: „Ich will mich kraftvoll und lebendig fühlen.“
Letztere sind emotional aufgeladen und körperlich spürbar – sie aktivieren das gesamte System und schaffen eine innere Kohärenz, die Veränderung möglich macht.
So funktioniert das ZRM – in fünf Schritten
Zielklärung: Was will ich wirklich – nicht nur rational, sondern auch emotional?
Bild- und Wortressourcen finden: Welche inneren Bilder geben mir Kraft?
Embodiment nutzen: Körperhaltung und Bewegung als Verstärker der Motivation.
Selbstwirksamkeit stärken: Kleine, konkrete Schritte statt großer Vorsätze.
Training und Wiederholung: Veränderung braucht Wiederholung – wie ein Muskel, der wachsen will.
Ein Beispiel: Statt sich zum Joggen zu zwingen, kann das Ziel lauten: „Ich bewege mich wie ein Panther – kraftvoll, geschmeidig, frei.“ Dieses Bild aktiviert positive Emotionen und macht den ersten Schritt leichter.
Fazit: Veränderung beginnt im Inneren – nicht erst im Umbruch
Veränderung ist kein Kampf gegen sich selbst, sondern ein Prozess der Selbstverbindung. Wer versteht, wie das eigene Gehirn funktioniert – und wie man mit den eigenen Ressourcen arbeitet – kann Veränderung nicht nur denken, sondern auch leben.
Das Zürcher Ressourcen Modell zeigt: Der Schlüssel liegt nicht im „Müssen“, sondern im „Wollen mit Gefühl“. Und das ist nicht nur motivierend – sondern neurobiologisch klug.
Workshop: Veränderung erleben – in Lichtenberg bei Linz
Wenn du das Zürcher Ressourcen Modell in der Praxis kennenlernen möchtest, lade ich dich herzlich zu meinem Workshop ein:
„Schluss mit ...! Veränderung erfolgreich gehen“

Teil 1: Mittwoch, 01. 10.2025, 17:30–19:30
Teil 2: Mittwoch, 08. 10.2025, 17:30–19:30
Ort: Vitalzentrum Lichtenberg bei Linz, Gisstraße 1, 4040
Für 2 bis max. 6 Teilnehmer:innen
Kosten: € 97 gesamt
Anmeldung: kontakt@freivogel.at
Du hast Interesse, aber es fehlt dir die Zeit, melde dich gerne bei mir!
Erlebe wie Veränderung funktionieren kann.




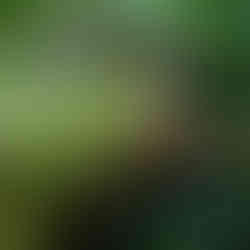










Kommentare